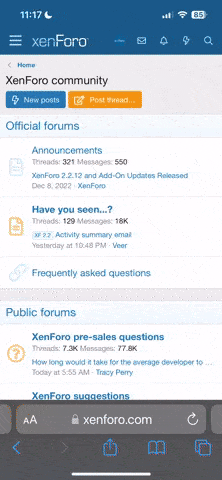Die Haupterntezeit von Kakao in Mexiko ist von Oktober bis Februar, die Nebenzeit März bis August. Es dauert etwa vier bis neun Monate bis der Kakaobaum nach der Befruchtung reife Früchte trägt. Beim Ernten muss darauf geachtet werden, dass die Fruchtansätze am Baum bleiben, denn da treiben die nächsten Blüten heraus. Die reifen Früchte fallen nie von selbst ab und würden am Stamm verfaulen, würde man sie nicht erntet. Die abgeschnittenen Früchte werden in großen Körben gesammelt und zu einer zentralen Sammelstelle gebracht. Dort werden sie zuerst zu Haufen geschichtet und dann nach und nach mit einer Machete geöffnet, um das Fruchtfleisch (Pulpa) mitsamt den klebrigen Bohnen zu entfernen.
Die Früchte werden in reifem Zustand gepflückt, die Samen ausgelöst, fermentiert, wodurch die Geschmacksstoffe hervorgehoben werden, und getrocknet. Die getrocknete Kakaobohne besteht aus der Schale, die für die Ernährung unbrauchbar ist, und dem Kern. Dieser Kern wird gemahlen und als Kakaopulver angeboten. Kakaopulver ist stark ölhaltig und kann als Emulsion gelöst werden.
An Ort und Stelle erwarben wir eine Tüte frisch gerösteter Kakao-bohnen, bei denen der kräftige Kakaogeschmack schon recht deutlich wahrzunehmen ist. Allerdings haben sie einen bitteren Nachge-schmack.
Auf dem Rückweg zum Bus kamen wir auch wieder an dem Käfig mit dem kleinen Äffchen vorbei, der hier die Hauptattraktion der weiblichen Mitreisenden, weil er so „niedlich“ sei, war. Die Fahrt zu den Ruinen und Tempelanlagen Palenques dauerte nicht lange und schon befanden wir uns an der 1780 Hektar großen Parkanlage, die eine der wichtigsten archäologischen Stätte und einige der größten Kultur-schätze Mexikos beherbergt.
Hier am Eingang der Tempelanlage kaufte Anne einem kleinen Jungen einen rechteckigen Anhänger mit ihrem Sternzeichen als Halsschmuck ab. Kurz darauf betraten wir die Tempelanlage.
Die einstige Maya-Stadt umfasste 16 Quadratkilometer. Bis heute ist jedoch nur ein Bruchteil der Fläche freigelegt worden, der Rest liegt noch immer im Dickicht des Dschungels verborgen.
Die Anzahl aller Gebäude wird auf über 500 geschätzt, wobei erst zehn bis 15 Prozent freigelegt wurden. Typisch für den Baustil der Palenque-Tempel sind ihre relativ breiten Eingänge und ganz besonders ihre steilen Mansardendächer, oft dekoriert mit Skulpturen und gekrönt von durchbrochenen, gitterartigen Dachkämmen, den Cresterías. Diese Kämme erzeugen eine optische Erhöhung, wodurch die Tempel weit weniger wuchtig wirken. Ein besonderes Charakteristikum von Palenque sind die künstlerisch exzellenten Stucktableaus im Innern der Tempel der Kreuzgruppe. Sie zeigen Abbildungen früherer Herrscher und wichtige Szenen ihrer Regentschaft.
Erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts fanden spanische Siedler diese Ruinen, erfassten aber nicht die Bedeutung der grasüberwucherten Hügel, unter denen versteckt Pyramiden lagen. Im Jahre 1787 wurde die Stadt ein weiteres Mal entdeckt.
Es folgten zahlreiche archäologische Untersuchungen und Aus-grabungen, die immer noch andauern. Die unsachgemäßen Methoden der Freilegung, wie zum Beispiel mittels Abbrennen der Über-wucherungen, von Seiten der ersten Entdecker, haben sehr viel Schaden verursacht. So wurden unter anderem Stuckverkleidungen unwieder-bringlich zerstört.
Die Maya nannten die Stadt „Na-Can-Caán“, was so viel heißt wie „Haus der himmlischen Schlangen“. Regiert wurde dieses Gebiet von einem "k'uhul ajaw" (göttlicher König). Über die ersten Herrscher von Palenque ist bisher wenig bekannt. In den hieroglyphischen Chroniken taucht zum ersten Mal 397 nach Christus der Herrscher „Bahläm-K’uk“, der mit 34 Jahren den Thron bestieg, auf. Es folgten ihm neun weitere Regenten. Die Bauten entstanden hauptsächlich in der Zeit von 600 - 900 nach Christus.
Mit Pacal, dem wohl bekanntesten Herrscher, begann für Palenque das goldene Zeitalter.
615 nach Christus wurde Pacal im Alter von zwölf Jahren inthronisiert und er regierte bis ins hohe Alter von 68 Jahren. Ungewöhnlich ist, dass vor Pacal nicht sein Vater herrschte, sondern seine Mutter.
Zur Zeit der Inthronisierung von Pacal lebte seine Mutter noch. Sie starb 20 Jahre später. Nach dem Tod von Pacal übernahm sein ältester Sohn Bahlum-Chan die Regentschaft und herrschte bis zum Jahre 702 nach Christus. Im Anschluss übernahm sein Bruder K’an Xul die Regentschaft. Um 950 nach Christus wurde die Stadt aus bisher nicht geklärten Gründen von den Maya verlassen und der Urwald ergriff wieder Besitz von den Tempeln und Palästen.
Uns überwältigte als Erstes der Blick auf die alten Steine, die wirklich inmitten von saftigem Grün wahrzunehmen sind, so wie der „Templo de Calavera“, der Schädel- oder Totenkopftempel. Er ist das erste Gebäude gleich nach dem Eingang. Der rechte Teil ist verfallen und wurde noch nicht rekonstruiert. Geht man die Treppe hoch, ist an dem linken Pfeiler links unten ein hasenkopfähnlicher Stuckschädel zu er-kennen. Von ihm hat der Tempel seinen Namen. Wie alle Tempel Palenques war er einst blau und rot bemalt.
Direkt links daneben liegt der „Tempel XIII“, in dem erst 1994 in einer zugebauten Kammer der Steinsarkophag gefunden wurde, in dem das Skelett einer etwa 1,70 Meter großen Frau mit einer Jademosaik-Maske gefunden wurde. Der Fund wurde wegen des roten Sarges "La Reina Roja", Tempel der roten Königin, getauft.
Der „Templo de la Inscriptiones“, der Tempel der Inschriften, ist nicht nur das interessanteste Bauwerk Palenques, sondern auch eines der bekanntesten Maya-Monumente Mesoamerikas überhaupt. Es wurde von 675 bis 683 nach Christus erbaut.
Diese klassische Pyramide ist mit dem Tempelaufsatz 21 Meter hoch, besteht aus neun aufeinander gesetzten Sockeln und ist deutlich größer als alle anderen Tempel Palenques. Auf den sechs Pfeilern, die die fünf Eingänge zum Tempel umrahmen, kann man Figuren aus Stuck er-kennen, links und rechts vom Haupteingang sind 620 Hieroglyphen eingemeißelt. Diese Inschrift, der das Gebäude seinen Namen verdankt, scheint hauptsächlich die Familienchronik der Herrscher von Palenque zu enthalten.
Im Jahre 1949 wurde in der mittleren Kammer ein Zugang zu einer von Schutt bedeckten Treppe entdeckt. Hinter einer gemauerten Wand befand sich eine aufrecht stehende, dreieckige Platte mit sechs Skeletten davor. Hinter der Steinplatte wurde eine Krypta unter der Tempel-plattform freigelegt. Darin befindet sich ein monolithischer Sarkophag mit einer ihn bedeckenden Steinplatte mit den Maßen von 3,8 mal 2,2 Metern, einer Stärke von 25 Zentimetern und einem Gewicht von zirka acht Tonnen, die mit einem Relief geschmückt ist.
Die Kammer liegt einige Meter unter dem Fundament der eigentlichen Pyramide. Die Pyramide wurde somit über diesem Grab errichtet und war von Beginn an als Grabmonument geplant. Sie enthält die Toten-gruft des bedeutendsten Palenque-Herrschers Pacal, welcher im Jahre 983 seine letzte Ruhe fand, und wurde von seinem Sohn Chan-Bahlum II im Jahr 682 auf der zuvor fertig gestellten Krypta Pacals vollendet.
Pacal sitzt auf einer Maske, die den Erdgott darstellt. Über dieser Szene wölbt sich ein kreuzartiges Gebilde, welches wahrscheinlich die "Ceiba", den heiligen Lebensbaum der Mayas, darstellt.
Seit der Schriftsteller Erich von Däniken in dieser Abbildung auf dem Sarkophagdeckel angeblich einen "Raumfahrer" erkannte, wollten so viele Besucher in diese Krypta, dass nun der Tempel der Inschriften für Besucher gesperrt ist. Leider darf man auf diese Pyramide nicht hinauf und schon gar nicht hinein.
Erich von Däniken muss wohl angesichts der reichen Verzierungen die Fantasie durchgegangen sein, denn wer Augen im Kopf hat und sich minimal über die Mythologie der Mayas informiert, erkennt ganz deutlich den Kopf eines Unterweltgottes, darauf Pacal, der hinab in das Reich der Toten gleitet und darüber das typische kreuzförmige Welten-baumsymbol mit dem Himmelsvogel. Das Weltenbaumsymbol ist auf-grund seiner Deutlichkeit, Informationen in erhaltenen Mayaschriften und der Häufigkeit vergleichbarer Darstellungen absolut nicht umzu-deuten, so gern Herr Däniken hier auch ein Ufo sähe.
Der Ceiba-Baum, der in der Mayasprache „Yaxché“ oder „Pochote“ genannt wird, ist auch bekannt als Kapok-Baum.
Der Ceiba-Baum kann eine Höhe von bis zu 70 Metern erreichen und der Durchmesser des Stammes liegt zwischen drei und fünf Meter. Die Blüten sind groß und die vielen Früchte, die von einer Art Baumwolle bedeckte Samen enthalten, sind zwischen zwölf und 18 Zentimeter groß. Die Blütezeit liegt zwischen August und September.